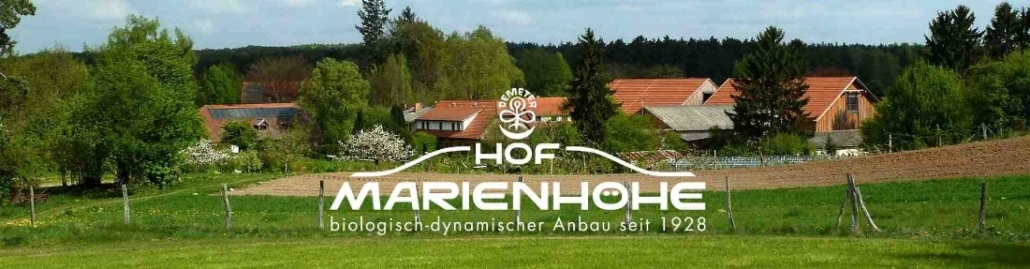
1928 erwarb der akademische Landwirt Erhard Bartsch in der Nähe des Scharmützelsees das Gut Marienhöhe. Nach dem Ende des Weltkriegs hatte der Anthroposoph ein Praktikum auf dem Gut Koberwitz absolviert, dessen Gutsverwalter Rudolf Steiner sehr zugetan war. Bartsch war einer der beiden, die 1924 Rudolf Steiner zu einem später legendär gewordenen Kurs über “Grundlagen der biologisch-dynamischen Landwirtschaft” anregten. Wie kam es zu derartigen Aktivitäten?
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelte sich in Deutschland und in der Schweiz eine moderne Esoterik, die Theosophie, deren Gesellschaft Rudolf Steiner als Generalsekretär vorstand. Er erweiterte die Theosophie um naturwissenschaftliche sowie christlich-abendländische Sichtweisen zur Anthroposophie.
Es war auch die Zeit der Lebensreform, die sich gegen Industralisierung und Urbanisierung wandte, gegen die Moderne, die das Elend des Industrieproletariats und der Kriege brachte. Die Lebensreform wandte sich gegen den Materialismus und strebte nach einem Naturzustand, eine Sichtweise, die auch der Rudolf Steiners entsprach.
Es war eine bunte Mischung unterschiedlichster Initiativen: Wanderfreunde, Nudisten, Rhönradfahrer, Vegeetarieer, Bildende Künstler, Schriftsteller, Obstbauern, Naturheilkundler, aber auch völkische (teilw. auch rassistisch und antisemitische) Strömungen. Die Ausstellung des Hauses der Brandenburgisch Preußischen Geschichte “Einfach. Natürlich. Leben — Lebensreform in Brandenburg 1890–1939” zeigt dies mit vielen Beispielen und ist im gleichnamige Buch [ISBN 978–3‑945256–23‑7] gut dokumentiert.
100 Jahre zuvor hatte Albrecht Thaer, die wissenschaftliche Agronomie begründet. Im Zuge der Aufklärung entwickelt er eine empirische, rationale und ökonomische Basis, die einen freien Bauernstand voraussetzte. Die Abschaffung der Leibeigenschaft war ja auch eine zentrale Forderung während der Aufklärung gewesen.
Während Thaer den Boden und die Produktion optimierte, um nachhaltig wirtschaftlichen Ertrag zu sichern, strebte Steiner — nach den Schrecken des Weltkrieges und einer dreiviertel Million Verhungerten — zu einer umfassenden Gesundung von Boden, Pflanzen, Tieren und Menschen in einer ganzheitlichen und kosmisch eingebetteten Landwirtschaft an. Beiden gemeinsam ist ein Streben nach Nachhaltigkeit und Bodenfruchtbarkeit.
Im Kern betrachtet Steiner das Gedeihen der Pflanzen in der Beteiligung des „ganzen Himmels mit seinen Sternen“ sowie des Lichtäthers der Erde. Ätherische Kräfte des Bodens seien zu verbessern, denn beim Essen werden nicht nur Substanzen der Nahrungsmittel, sondern auch „mit den Nahrungsmitteln die Lebendigkeit der Kräfte“ aufgenommen. So erfährt die Erde beim Düngen ihre „Verlebendigung“. Nun mag man derartige Betrachtungen als esoterisch ablehnen – interessant ist jedoch, dass der Ruf der Verlebendigung des Bodens angesichts der Agrarsteppen mittlerweile ein weit verbreiteter ist.
In den weiteren Vorträgen dieser Reihe beschäftigte sich Steiner folglich mit der Düngung, der Vermeidung von Schädlingen und Pflanzenkrankheiten, das Verhältnis von Feld‑, Obst- und Viehwirtschaft. Gleich nach dem Vortrag wurde ein anthroposophischer Versuchsring gegründet, was über mehrere Etappen dann 1932 in der Gründung des Bio-Anbauverbandes Demeter seinen Höhepunkt erreichte.
Bartsch begann sogleich Hecken zur Steigerung der Biodiversität sowie zur Vermeidung von Erosionen anzupflanzen, Gründüngepflanzen, Getreide und Hackfrüchte. Die herunter gekommene Rinderherde galt es aufzubauen. Das Modellhafte dieses ersten biodynamischen Hofs war das Prinzip eines geschlossenen Betriebsorganismus.
Nach dem Krieg zog Bartsch nach Österreich und überließ den Hof seinen Mitarbeiter/innen. Als österreichischer Besitz wurde er nicht kollektiviert. 1991 schenkten seine Erben den Hof dem hierfür gegründeten Gemeinnützigen Verein Marienhöhe.
Hofführungen finden an jedem letzten Samstag eines Monats statt und haben jeweils spezielle Schwerpunkte, die im Internet frühzheitig angekündigt werden.
Auf armen, sandigen Böden mit bis zu nur 8 Bodenpunkten (der 100-stufigen Skala) und Niedermoorwiesen bei trockenem Kontinentalklima werden Kiefern- zu Mischwald umgebaut, Feldhecken unterhalten sowie Äcker, Gärtnerei und mit seltenen Obstsorten bestückte Streuobstwiese bewirtschaftet. Das Obst bedarf der Imkerei und der Viehbestand ist unendlich schön: Deutsches Sattelschwein, Rotes Höhenrind und Altdeutscher Hütehund.
Wie alle biodynamischen Höfe arbeitet Marienhöhe nach jährlich aktualisierten Richtlinien des Demeter Vereins . Diese sind sehr umfassend und behandeln nicht nur Düngung, Saatgut, Pilze, Obst- und Weinbau sowie Tierhaltung, Fütterung und Imkerei, sondern auch Verarbeitungsrichtlinien für Obst und Gemüse, Back- und Fleischwaren, Bier und Wein sowie Kosmetika, Textilien und auch Säuglingsmilchnahrung.
Einen hervorragende Darstellung der Entwicklung und der Ziele der ökologischen Landwirtschaft gibt das arte-Video “Die Bio-Revolution — Die Karriere der ökologischen Landwirtschaft”.
Demeter ist der erste Bio-Verband und heutzutage neben Naturland und Bioland der drittgrößte. Seine anthroposophische Ausrichtung wird immer wieder in der Öffentlichkeit und in den Medien kritisch diskutiert, vor allem wegen der Haltung während des Nationalsozialismus und spezifischer als Esoterik kritisierter landwirtschaftlicher Verfahren.
Die anthroposophischen Organisationen waren nicht Bestandteil des nationalsozialistischen Staates. Führende Vertreter, auch Erhard Bartsch, kooperierten jedoch mit ihm, zum Teil in Konzentrationslagern und zum Teil in besetzten Gebieten, insbesondere in der Ukraine. Ebert, zur Nieden und Pieschel haben dies in “Die biodynamische Bewegung und Demeter in der NS-Zeit” (Metropol) detailliert beschrieben. Analoges gilt für Weleda.
Das Problem ist, das mit dieser historischen Last nicht offen umgegangen, sondern diese seit Jahrzehnten nur peu à peu eingeräumt wird. Der Anthroposophie damit eine Nähe zum Nationalsozialismus anzuhängen, ist jedoch unredlich und erfolgt in analogen Fällen, wie zum Beispiel beim “Verein für Deutsche Schäferhunde”, ja ebenfalls nicht.
Es gab übrigens deutliche Gegner, z. B. Ita Wegmann, die zusammen mit Steiner die anthroposophische Medizin begründete, und Hans Büchenbacher, der bis 1934 Vorsitzender der “Deutschen Anthroposophischen Landesgesellschaft” war und als “Halbjude” emigrierte.
Die immer wieder die Diskussion anheizenden Besonderheiten der biologisch-dynamischen Landwirtschaft sind unter anderem der Einsatz spezieller Präparate, wie Hornmist, und die Berücksichtigung von Mond- und Planetenzyklen. Die Haltung von Rindern mit Hörnern (und keine hornlosen Züchtungen) ist vorgeschrieben sowie die Enthornung verboten. Das wird von vielen Menschen kritisch gesehen, vor allem der Präparat wegen. Ich bin davon nicht überzeugt, meine jedoch, dass man die Kirche im Dorf lassen solle. Für mich ist wesentlich, dass die Bodenfruchtbarkeit erhalten und mit den Tieren ihnen gemäß umgegangen wird. 96 % der Schweine stehen in Deutschland auf Spaltenböden, kein einziges in einem anthroposophischen Hof. Das zählt und nicht die Frage, ob mit oder ohne Hornmist und ob mit oder ohne Vollmond.
Ich bin kein Anthroposoph und habe als Biologe mich in frühen Jahren mit Populationsgenetik beschäftigt. Wenn Einrichtungen wie der Dottenfelder Hof (Demeter) mit der Züchtung von samenfesten Populationen der industriellen Hybridzüchtung entgegentreten, sehe ich einen wesentlichen Beitrag für Biodiversität und wirtschaftliche Unabhängigkeit, ohne die es keinen freien Bauernstand gibt. Für mich ist das ein Idealbild, doch es bedarf, die Macht der Konzerne für Saatgut, Dünger und Lebensmittel zu brechen, wie Schrot&Korn referierte.
